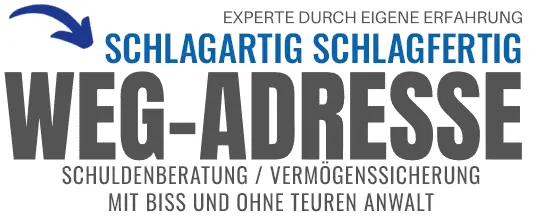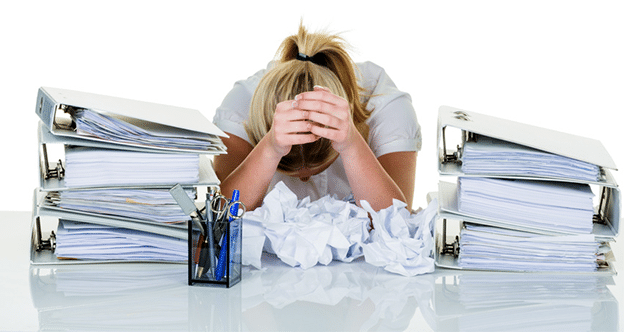Ob jemand wirklich die schweren Nachteile einer Privatinsolvenz tragen muss, entscheidet sich oft an einem unsichtbaren Punkt – dort, wo aus Verschuldung langsam Überschuldung wird. Eine genaue Zahl gibt es dafür nicht. Doch Schuldnerberater und Statistiken zeigen: Wenn die gesamten Schulden höher sind als das gesamte Jahreseinkommen, ist dieser Punkt meist überschritten.
In Deutschland betrifft das seit Jahren rund 6,9 Millionen Menschen – ein stilles Drama. Besonders erschütternd: Etwa 45 Prozent der Überschuldeten sind Familien oder Alleinerziehende mit Kindern. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal, das von Sorgen, Angst und schlaflosen Nächten geprägt ist.
Für viele bleibt am Ende nur ein einziger Ausweg – der Weg in die Privatinsolvenz. Doch dieser Weg ist steinig. Er bedeutet nicht nur Papierberge, Formulare und Pfändungstabellen. Er bedeutet, dass man über Jahre mit finanziellen Fesseln lebt, auf vieles verzichten muss und sich immer wieder erklären soll.
Die Privatinsolvenz kann ein Neuanfang sein – aber sie verlangt einen hohen Preis. Sie bringt tiefe Einschnitte in das eigene Leben, in die Partnerschaft, in die Zukunftspläne. Selbst Ehepartner sind oft indirekt betroffen. Viele, die den Schritt gehen, fühlen sich wie in einem Tunnel – mit Licht am Ende, ja, aber einem langen und dunklen Weg dorthin.

Darum gilt: Bevor man sich für die Privatinsolvenz entscheidet, sollte man sehr genau prüfen, ob es wirklich keine andere Lösung gibt. Manche Anwälte empfehlen sie zu schnell – doch was auf den ersten Blick wie eine Abkürzung zur Schuldenfreiheit wirkt, kann sich als jahrelange Belastung entpuppen.
Die Privatinsolvenz führt zweifellos zu vielen Nachteilen – finanziell, sozial, psychisch. Wer diesen Schritt gehen muss, sollte ihn bewusst, informiert und mit professioneller Begleitung gehen. Denn nur wer die Schattenseiten kennt, kann den Neustart wirklich schaffen.
Ziehen Sie daher besser alle Alternativen vorher in Betracht. Wie Sie das sehr clever und vollkommen legal machen können, zeige ich Ihnen hier gern.
Was sind die Nachteile einer Privatinsolvenz?
Das Verfahren führt anders als oft angenommen nicht zur absoluten Schuldenfreiheit. Die Nachteile lassen sich in 6 Kategorien einteilen:
Einschränkungen bei Einkommen und Vermögensverwendung
- Einschränkungen bei Einkommen und Vermögensverwendung
- Negative Folgen für Bonität und Vertragsabschlüsse
- Öffentliche Wahrnehmung und persönliche Belastung
- Berufliche und gesellschaftliche Nachteile
- Hoher organisatorischer Aufwand und Verfahrenskosten
- Nicht alle Schulden werden vollständig erlassen
Beispiel: Einschränkungen bei Einkommen und Vermögensverwendung
- Während der Wohlverhaltensphase – in der Regel drei Jahre bei Verfahren ab dem 1. Oktober 2020 – müssen Schuldner strenge gesetzliche Pflichten erfüllen.
- Der pfändbare Anteil des Einkommens oberhalb der Pfändungsfreigrenze wird vom Treuhänder bzw. Insolvenzverwalter einbehalten. Quelle: Auxmoney
- Auch vorhandenes Vermögen fällt in die Insolvenzmasse. Wertgegenstände, die über das notwendige Existenzminimum hinausgehen, dürfen verkauft werden.
- Schuldner sind verpflichtet, jede Änderung von Wohnsitz, Arbeitsplatz oder Vermögensverhältnissen – etwa Erbschaften – mitzuteilen.
- Nach dem Ende des eigentlichen Insolvenzverfahrens folgt eine dreijährige Wohlverhaltensperiode, in der weiterhin zahlreiche finanzielle und rechtliche Einschränkungen gelten.
Beispiel: Negative Folgen für Bonität und Vertragsabschlüsse
- Das Insolvenzverfahren wird öffentlich bekannt gemacht – die Veröffentlichung erfolgt durch das zuständige Insolvenzgericht.
Quellen: t-online.de - Einträge bei der SCHUFA oder anderen Auskunfteien beeinträchtigen die Kreditwürdigkeit erheblich und erschweren neue Vertragsabschlüsse.
- Eine Privatinsolvenz führt in der Regel zur Kündigung bestehender Kredite. Überzogene Konten werden fällig gestellt. Zwar kann ein Pfändungsschutzkonto eingerichtet werden, doch schützt es nicht vor Kreditkündigungen.
- Ein Wohnungswechsel ist kaum möglich, da Vermieter eine Schufa-Auskunft verlangen. Eine negative Bonität führt häufig zur Ablehnung.
- Neue Kredite, Handyverträge oder Ratenkäufe sind in der Regel nicht mehr möglich. Selbst Verträge über den Ehepartner sind schwierig, da auch dieser indirekt betroffen ist.
Quelle: t-online.de - Auch Anbieterwechsel bei Strom, Gas, Internet oder Telefon sind erschwert oder unmöglich.
- Bestellungen im Versandhandel sind oft nicht mehr möglich, da Händler vor Lieferung Bonitätsprüfungen durchführen.
Beispiel: Öffentliche Wahrnehmung und persönliche Belastung
- Das Insolvenzverfahren ist öffentlich einsehbar, unter anderem über die amtlichen Insolvenzbekanntmachungen.
- Die vollständige Offenlegung der eigenen finanziellen Situation und der Zwang zu einem strikten Lebensstil führen oft zu erheblicher psychischer Belastung.
- Auch der Ehepartner wird häufig in Mitleidenschaft gezogen, da das Einkommen bei Berechnungen teilweise berücksichtigt wird.
Beispiel: Berufliche und gesellschaftliche Nachteile
- Gehaltspfändungen sind im Rahmen der Privatinsolvenz üblich. Das kann zu Konflikten mit dem Arbeitgeber führen.
- Der Arbeitgeber erfährt in der Regel von der Insolvenz, da er verpflichtet ist, den pfändbaren Teil des Gehalts direkt an den Treuhänder abzuführen.
- Eine Tätigkeit als Geschäftsführer oder in leitender Position ist während des Insolvenzverfahrens in der Regel ausgeschlossen.
- Eine selbstständige Tätigkeit ist nur mit erheblichen Einschränkungen möglich, insbesondere wenn Schulden gegenüber dem Finanzamt bestehen.
Beispiel: Hoher organisatorischer Aufwand und Verfahrenskosten
Das Insolvenzverfahren erfordert umfangreiche Unterlagen, Dokumentationen und die enge Zusammenarbeit mit dem Insolvenzverwalter.
Hinzu kommen erhebliche Verfahrenskosten, bestehend aus Gerichtsgebühren und der Vergütung des Treuhänders. Eine Stundung ist möglich, die Schuldenlast bleibt jedoch bestehen.
Beispiel: Nicht alle Schulden werden vollständig erlassen
Einige Forderungen sind von der Restschuldbefreiung ausgenommen, etwa Geldstrafen, Unterhaltsrückstände oder Schulden aus vorsätzlich unerlaubten Handlungen.

Privatinsolvenz Vor- und Nachteile kurz zusammengefasst?
Die Vor- und Nachteile der Privatinsolvenz müssen genau gegeneinander abgewogen werden, um für den Einzelfall die optimale Lösung des Schuldenproblems zu finden. Deshalb stelle ich nachfolgend die Vorteile und Nachteile kurz gegenüber.
- Schulden- und Vermögenslage prüfen
- Wie hoch sind Ihre Gesamtverbindlichkeiten?
- Gibt es Vermögen, das zur Insolvenzmasse gehört (z. B. Auto über dem notwendigen Minimum, Immobilie, Beteiligungen)?
- Liegen Schulden vor, die von der Restschuldbefreiung ausgeschlossen sind (z. B. Unterhaltsforderungen, Geldstrafen, Schulden aus vorsätzlichen unerlaubten Handlungen)?
- Einkommen & Pfändungslage analysieren
- Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen? Liegt es über den Freibeträgen (z. B. 1.555 Euro) sodass regelmäßig pfändbares Einkommen anfällt?
- Haben Sie Unterhaltsverpflichtungen, durch die sich der Freibetrag erhöht?
- Wie viel Einkommen könnte gemäss aktueller Tabelle pfändbar sein? (→ mit obigen Zahlen rechnen)
- Würde bei einer Insolvenz und Anteilabführung noch genug verbleiben, um den Lebensunterhalt und ggf. Auflagen zu erfüllen?
- Auflagen & Belastung der Wohlverhaltensphase
- Können Sie die Erwerbsobliegenheit erfüllen (also eine angemessene Arbeit aufnehmen bzw. nicht unzumutbare Jobs ablehnen)?
- Sind Sie bereit, während der Wohlverhaltensphase (3 Jahre) die Verpflichtungen einzuhalten (z. B. Auskunftspflichten, Meldung von Änderungen, Abführung pfändbarer Beträge)?
- Können Sie mit der Öffentlichkeit und möglichen Einschränkungen (Bonität, Veröffentlichung des Verfahrens) leben?
- Kosten & Finanzierung sichern
- Haben Sie die Mittel oder eine Möglichkeit zur Stundung der Verfahrenskosten?
- Können Sie ggf. mit einer Beratungshilfe oder Schuldnerberatung Unterstützung erhalten? (z. B. Beratungshilfeschein) flegl-
- Haben Sie geprüft, ob eine außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern möglich ist (evtl. günstiger als Insolvenz)?
- Folgen für Zukunft & Bonität bedenken
- Wie wirkt sich die Insolvenz auf Ihre Kreditwürdigkeit, Mietverträge, Finanzierungsmöglichkeiten aus?
- Welche beruflichen Auswirkungen könnte eine Insolvenz haben (z. B. in Vertrauens- oder Finanzpositionen)?
- Ist Ihnen klar, dass trotz Restschuldbefreiung gewisse Schulden bleiben können oder dass die Phase der Belastung vorbei ist, aber nicht jede Nachwirkung?
- Alternativen prüfen
- Gibt es eine außergerichtliche Schuldenbereinigung (z. B. mit Schuldnerberatung) möglich?
- Ist ein gerichtlicher Schuldenvergleich möglich, bevor der Antrag auf Insolvenz gestellt wird?
- Ist eine Umschuldung oder ein individuelles Rückzahlungs- und Tilgungsplan denkbar?
- Option die „Weg-Adresse“ bietet
Wer bezahlt die Schulden bei Privatinsolvenz?
Bei einer Privatinsolvenz bleibt die Pflicht zur Rückzahlung der Schulden grundsätzlich beim Schuldner. Die praktische Abwicklung übernimmt jedoch ein Insolvenzverwalter.
Dieser erstellt eine Übersicht aller Gläubiger und legt fest, wie das verfügbare Geld verteilt wird – das nennt man Quotelung. Dabei erhalten die Gläubiger Geld entsprechend der Höhe ihrer Forderungen im Verhältnis zur Gesamtschuld.
Wichtig ist dabei auch die Rangfolge der Schulden. In Deutschland gilt zum Beispiel: Unterhaltsforderungen für minderjährige Kinder haben immer Vorrang vor anderen Schulden.
Wie viel tatsächlich an die Gläubiger gezahlt wird, hängt vom pfändbaren Einkommen des Schuldners ab.
Liegt das Einkommen während der gesamten Wohlverhaltensphase unter der Pfändungsfreigrenze, können keine Zahlungen geleistet werden. Gibt es außerdem kein pfändbares Vermögen (z. B. Sparguthaben oder Versicherungen), spricht man von einer „Null-Insolvenz“. In diesem Fall gehen die Gläubiger leer aus, der Schuldner erhält aber am Ende die Restschuldbefreiung.
Was sind die Folgen einer Privatinsolvenz?
Eine der wichtigsten Folgen ist, dass der Schuldner die Kontrolle über sein Vermögen und Teile seines Einkommens verliert. Alles, was über dem Pfändungsfreibetrag liegt, wird vom Insolvenzverwalter verwaltet und an die Gläubiger verteilt.
Zudem darf der Schuldner keine neuen Kredite aufnehmen. Das bedeutet, dass größere Anschaffungen – etwa eine eigene Immobilie oder Renovierungen – in dieser Zeit nicht möglich sind. Auch eine Selbstständigkeit lässt sich nur schwer verwirklichen, da dafür meist Kredite oder Fördermittel nötig wären, die in der Insolvenz nicht gewährt werden.
Neben diesen finanziellen Einschränkungen hat die Privatinsolvenz auch langfristige Folgen für die Bonität. Selbst nach Abschluss des Verfahrens bleibt der Schufa-Eintrag noch mindestens drei Jahre bestehen. In dieser Zeit ist es weiterhin schwer, Verträge abzuschließen, Kredite zu erhalten oder eine neue Wohnung zu finden.
Privatinsolvenz und die Folgen für die Kinder
Etwa 45 Prozent aller überschuldeten Menschen in Deutschland leben mit Kindern. Für diese Familien ist eine Privatinsolvenz besonders schwer – denn die finanziellen und seelischen Folgen betreffen nicht nur die Erwachsenen.
Zwar schützt das Gesetz Kinder davor, dass ihr laufender Unterhalt während einer Insolvenz gekürzt wird. Doch die Realität sieht oft anders aus: Viele Eltern schämen sich, Hilfe von Fördervereinen oder sozialen Einrichtungen anzunehmen. Sie möchten ihren Kindern nicht zeigen, wie eng das Geld wirklich ist – und genau das führt oft dazu, dass die Kinder still verzichten müssen.
Klassenausflüge, Vereinsbeiträge oder Freizeitaktivitäten – Dinge, die für andere selbstverständlich sind, werden plötzlich zum Problem. Kinder spüren schnell, wenn sie außen vor bleiben, und leiden darunter, ohne genau zu verstehen, warum.
Kommt es während einer laufenden Insolvenz zu einem Todesfall, können Sorgeberechtigte die Kinder vor zusätzlichen Belastungen schützen. Gehören die Kinder zu den gesetzlichen Erben, können sie das Erbe ausschlagen, um keine Schulden zu übernehmen. Wichtig ist jedoch, dass dies innerhalb kurzer Fristen geschieht, meist innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntwerden des Erbfalls.
So schwer eine Privatinsolvenz auch ist – besonders Familien sollten sich nicht scheuen, Unterstützung zu suchen. Denn niemand sollte sich dafür schämen müssen, Hilfe anzunehmen, wenn es um das Wohl der eigenen Kinder geht.
Nachteile einer Privatinsolvenz – Privatinsolvenz Folgen für Ehepartner
Auch Ehepartner sind von einer Privatinsolvenz oft indirekt betroffen. Wie stark, hängt von mehreren persönlichen und rechtlichen Faktoren ab – allen voran vom gewählten Güterstand bei der Eheschließung.
Bei einer Gütergemeinschaft (§ 1415 BGB) gilt: Beide Ehepartner teilen ihr Vermögen. Das bedeutet, dass im Fall einer Privatinsolvenz auch der nicht verschuldete Ehepartner Teile der Kontrolle über sein Einkommen verliert. Der Insolvenzverwalter kann dann auf gemeinsames Vermögen zugreifen, um die Gläubiger zu befriedigen.
Anders ist es bei der Gütertrennung. Hier bleiben die Vermögenswerte strikt getrennt – das Eigentum des Ehepartners wird also nicht Teil der Insolvenzmasse.
In der Zugewinngemeinschaft, die in Deutschland am häufigsten vorkommt, gibt es einen Mittelweg: Das während der Ehe gemeinsam erworbene Vermögen wird im Insolvenzfall berücksichtigt. Dadurch kann es auch hier zu finanziellen Einbußen kommen, wenn gemeinsame Anschaffungen oder Rücklagen vorhanden sind.

Doch die Belastung ist nicht nur finanzieller Natur. Eine Privatinsolvenz bringt häufig auch gesellschaftliche Nachteile und seelischen Druck mit sich. Der gute Ruf kann leiden, vor allem, wenn das soziale Umfeld von der Insolvenz erfährt. Viele Ehepartner empfinden es als beschämend, mit der Insolvenz ihres Partners in Verbindung gebracht zu werden – auch wenn sie selbst keine Schulden haben.
Am Ende gilt: Eine Privatinsolvenz betrifft nie nur eine Person. Sie verändert das Leben einer ganzen Familie. Offene Kommunikation, rechtliche Beratung und gegenseitige Unterstützung sind in dieser Situation besonders wichtig, um gemeinsam einen Weg aus der Krise zu finden.
Ist eine Privatinsolvenz sinnvoll?
Eine einfache Antwort auf diese Frage gibt es nicht – denn jede finanzielle Situation ist anders. Ob eine Privatinsolvenz der richtige Weg ist, hängt immer von den individuellen Umständen ab.
Grundsätzlich sollte eine Insolvenz erst der letzte Schritt sein. Zuvor sollten alle anderen Möglichkeiten geprüft und ausgeschöpft werden – zum Beispiel eine Umschuldung, Ratenvereinbarungen oder der Versuch, sich mit den Gläubigern auf einen Vergleich zu einigen. Oft lassen sich so noch außergerichtliche Lösungen finden.
Wenn die Schulden jedoch sehr hoch sind oder keine realistische Aussicht besteht, sie in absehbarer Zeit vollständig zu tilgen, kann die Privatinsolvenz der ehrlichste und sinnvollste Ausweg sein. Sie bietet die Chance auf einen finanziellen Neuanfang – auch wenn der Weg dorthin anspruchsvoll ist.
Besonders für Menschen, die sich durch ihre finanzielle Lage überfordert oder psychisch belastet fühlen, kann die Privatinsolvenz eine Entlastung darstellen. Viele organisatorische Aufgaben übernimmt dann der Insolvenzverwalter, was Druck und Verantwortung deutlich mindert.
Wichtig ist: Niemand sollte aus Angst vor den Verfahrenskosten auf diesen Schritt verzichten. Das deutsche Insolvenzrecht sieht ausdrücklich die Möglichkeit vor, die Gerichts- und Verwalterkosten zu stunden. So kann das Verfahren auch dann durchgeführt werden, wenn momentan keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.
Privatinsolvenz: Alternativen voll ausschöpfen
Die Anmeldung einer Privatinsolvenz sollte immer der letzte Ausweg bleiben. Das gebietet allein die Fairness gegenüber den Gläubigern. Sie bleiben bei einer Insolvenz auf Teilen ihrer Forderungen (wenn nicht sogar auf ihren kompletten Forderungen) sitzen. Wer eine Insolvenz anmeldet, sollte sich stets der Tatsache bewusst sein, dass er möglicherweise die wirtschaftliche Basis seiner Gläubiger zerstört. Es ist also notwendig, vor einer Privatinsolvenz alle Alternativen zu prüfen und auszuschöpfen.
VERHINDERN SIE EINE PRIVATINSOLVENZ MIT EINEM CLEVEREM SCHULDENVERGLEICH – HIER >
Die Palette reicht von Umschuldungen (alle Kleinforderungen in einem Kredit zusammenfassen) über die Vereinbarung niedrigerer Raten und dem Verkauf von Wertgegenständen und Schmuck bis hin zur Beleihung von Immobilien und Guthaben in Versicherungen. Auch das Potenzial möglicher Einsparungen ist oftmals sehr groß. Beispiele dafür sind Umzüge in kleinere Wohnungen oder der Verzicht auf Leasingfahrzeuge. Eine weitere Alternative zur Privatinsolvenz ist die Erhöhung des Einkommens durch die Annahme von Nebenjobs.
Selbstbehalt bei Privatinsolvenz: Was ist wissenswert?
Der Fachbegriff für den Selbstbehalt bei Privatinsolvenz lautet Pfändungsfreigrenze. Dieser Grenzwert leitet sich aus dem Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer nach dem Paragrafen 32a des Einkommenssteuergesetzes ab. Für jede unterhaltspflichte Person erhöht sich die Pfändungsfreigrenze. Dafür nutzt der Gesetzgeber einen Durchschnittswert aus der jeweils gültigen Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt.
Die Differenz zwischen der so ermittelten Pfändungsfreigrenze und dem alle zwei Jahre neu festgelegten Höchstbetrag steht nur zu einem prozentualen Anteil für die Schuldentilgung bei einer Privatinsolvenz zur Verfügung. Dieser Anteil reduziert sich mit steigender Anzahl unterhaltsberechtigter Personen. Darüber hinaus ist wissenswert, dass beispielsweise Überstundenzuschläge nur anteilig und Urlaubsgeld gar nicht berücksichtigt werden. Das heißt, den Schuldnern steht ein höherer Selbstbehalt bei Privatinsolvenz zur Verfügung, als nach den fixen Angaben in der offiziellen Tabelle zu vermuten ist.
Ablauf Privatinsolvenz: Der Gesetzgeber macht klare Vorgaben
Der Ablauf der Privatinsolvenz gliedert sich in fünf verschiedene Abschnitte, die der Schuldner nacheinander durchlaufen muss. Als erster Schritt ist ein außergerichtlicher Einigungsversuch vorgeschrieben. Scheitert er, schließt sich der Antrag auf das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren an. Es startet mit einem Versuch, von den Gläubigern die Zustimmung zu einem Schuldenbereinigungsplan zu erhalten.
Scheitert dieser Versuch, eröffnet das Gericht von Amts wegen das Insolvenzverfahren und benennt einen Insolvenzverwalter. Daran schließt sich die sogenannte Wohlverhaltensphase an, die in Deutschland bei der Regelinsolvenz sechs Jahre dauert. Hat der Schuldner in dieser Zeit alle Pflichten aus dem Paragrafen 295 der Insolvenzordnung erfüllt, besteht die Chance auf eine Restschuldbefreiung nach der Schlussverteilung der noch vorhandenen Insolvenzmasse. Die Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung schließt die Privatinsolvenz ab.
Welche Privatinsolvenz Voraussetzungen müssen Schuldner erfüllen?
Die Voraussetzungen für eine Privatinsolvenz finden sich im Paragrafen 304 der Insolvenzordnung. Danach kommt die Verbraucherinsolvenz nur für natürliche Personen in Frage. Sie dürfen zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung beruflich nicht selbstständig tätig sein. Jedoch schafft die gleiche Rechtsnorm eine Ausnahme. Die (auch verkürzte) Privatinsolvenz ist unter bestimmten Bedingungen auch für ehemalige Selbstständige möglich.
Der Gesetzgeber spricht dort von „überschaubaren“ Vermögensverhältnissen. Das wird mit der Angabe „weniger als 20 Gläubiger“ präzisiert. Hinzu kommt die Bedingung, dass keine Forderungen aus Arbeitsverhältnissen offen sein dürfen. Das betrifft sowohl die Lohnzahlungen als auch die darauf entfallenden Beiträge zu den Sozialversicherungen sowie die abzuführende Lohnsteuer.
Sie brauchen Hilfe bei der Vorbereitung einer Privatinsolvenz? – Ich stehe Ihnen gern mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zur Seite. Nehmen Sie einfach unverbindlich telefonisch Kontakt mit mir auf.
Kostenloses Erstgespräch:
Rufen Sie mich jetzt gleich an unter +49 9191 / 83 999 84 oder 0152 / 25 96 04 13 kontaktieren mich über das Kontaktformular.